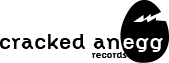Kurier Freizeit
Die Strottern singen die unerschrockensten Wienerlieder von ganz Wien. Egal, wo sie die ausgegraben haben, wer sie ihnen gespendet oder wie sie diese Lieder selbst geschrieben haben. Über die Erfolgsgeschichte einer großen, kleinen Band.
Dann greift David Müller in die Saiten seiner 120-jährigen Gitarre und beginnt das nächste Lied mit einem beschwingten d-d-pn-d-d-pnong-d-d-pn-d-d-pnong—wong —
Zwei Sekunden reichen, um das Publikum des gnadenlos überfüllten Café Heumarkt, wo die Strottern den fünften Geburtstag der Veranstaltungsreihe „einedrahn“ feiern, in Euphorie zu versetzen. Die Menschen rufen und klatschen, weil sie den Beginn des Strottern-Haderns „Wia tanzn is“ erkannt haben, und Klemens Lendl, der Sänger und Geiger der Strottern, unterbricht lächelnd die Herzrhythmusstörungen der Gitarre und sagt genüsslich: „Aaaaah.“
Als das Gelächter leiser wird, sagt er: „Das sind die einzigen zwei Sekunden, in denen wir uns wirklich als Stars fühlen.“
Nun ist das einerseits Tiefstapelei, denn die Strottern haben sich in der Szene des zeitgemäßen Wienerlieds längst ihren Platz erobert. Das heißt, sie werden nicht mehr in den Tschocherln und Hinterzimmern gebucht, wo Impresarios mit einem gewissen Faible für musikalische Zeitlosigkeit den beiden Herrschaften aus Klosterneuburg bei der Arbeit zuschauen wollten, egal ob sie dabei von viel Publikum gestört werden oder nicht.
Stattdessen treten die Strottern jetzt in gediegeneren Lokalitäten wie dem Mozartsaal im Konzerthaus auf, das heißt Gold, Stuck und viele hundert Zuschauer, und David Müller wiegt sorgenvoll den Kopf, so dass seine prächtigen schwarzen Locken betroffen zittern, und meint: „Das ist für uns aber jetzt wirklich die Obergrenze.“
Das findet Klemens Lendl auch. Nickend bestätigt er Davids Befund. Dabei sind sich die beiden sowieso einig (so wie sie sich überhaupt und permanent und geradezu auffällig einig sind über sämtliche Strottern-Agenden, vor allem über das Tempo des Komponierens: langsam. Lang-sam), wie diese Obergrenze zu verstehen ist, nämlich nicht als natürliche Sättigung des Publikumsinteresses, sondern als gesunde Einschätzung der Dimension eines Saals, der nur deswegen nicht größer sein darf als der Mozartsaal, weil dann vielleicht die besondere Intimität des Strotternsounds nicht mehr zum Tragen kommt. Der Strotternsound ist die Mischung aus dem sparsamen, trockenen Klang der Gitarre von David Müller und der entschlossen gezupften Geige Klemens Lendls– „hier, schau“, sagt er und zeigt mir eine Blase unter dem Fingernagel seines rechten Daumens, die er sich beim allzu wilden Pizzicato zugezogen hat – , wobei die Geige natürlich auch auf natürliche Weise, also gestrichen, zum Einsatz kommt, aber stets nur als sparsame Möblierung der Lieder, die Klemens Lendl und David Müller mit ihren Stimmen aufbauen.
Es sind Wienerlieder und Wienerlieder, solche und solche. Die Strottern – einander schon seit der Kindheit in Klosterneuburg bekannt, wo sie jetzt selbst mit ihren Familien leben und sich darüber beschweren, dass sie beim Einkaufen im Merkur plötzlich regelmäßig den neuen Vizekanzler treffen, den sie nun wirklich nicht gewählt haben – begannen als junge Männer, miteinander ein bisschen Jazz zu spielen. Sie traten bei allen möglichen Gelegenheiten auf, spielten bei Geburtstagen und Hochzeiten, und weil der Großvater Klemens Lendls gerne Wienerlieder hörte, nahmen sie ein paar ins Programm. „Sehr gern ins Programm“, präzisieren sie, weil es für die Wienerlieder nämlich immer besonders gutes Trinkgeld gab.
Außerdem passte der Rhythmus und Klang der Liedtexte besonders gut zur Stimme und dem schauspielerischen Talent Klemens Lendls, der sich im antiquarischen Wienerisch regelrecht einnisten konnte und den raunzigen, aus der Zeit gefallenen Liedern sein Gesicht und seine Gesten borgte. Gut war übrigens, was den Strottern gefiel, das muss betont werden, weil es für ihre Definition des Wienerlieds wichtig ist. Weder bei der Auswahl der Lieder noch bei deren Aufführung legten sie Wert auf die Etikette der Authentizität oder einer musikologischen Reinsortigkeit. Sie spielten Lieder, die ihnen gefielen, um zu gefallen; Lieder, die sie unterhielten, um zu unterhalten. Sie stiegen dabei nicht tief in die Archive, sondern orientierten sich durchaus am goscherten Gestus eines Kurt Sowinetz oder Helmut Qualtinger, die sich ihrerseits Wienerlieder zu eigen gemacht hatten, weil sie ideale Vehikel für Scherz und Sentiment waren; nicht mehr, aber natürlich auch nicht weniger.
Ihren Namen fischten die Strottern freilich aus einem der klassischen, einem der großen Wienerlieder namens „Wann i amal stirb“. Dort tauchen in der zweiten Strophe nämlich Strottern auf: „Ös liabe Leit, Leit, Leit, tuat’s es den Strotternsagn,/dass auf die Butt’n schlagn…“
Aus dem Wiener Mundartwörterbuch: „Strotter“ – „Gauner, Landstreicher, Strauchdieb“; aber auch Menschen, die „nach Verwertbarem suchen“. Als verwertbar erwiesen sich in diesem Zusammenhang für die Strottern vor allem jene alten Wienerlieder, „bei denen uns der Text nicht zu peinlich war“, sagt Klemens Lendl. „Die Melodien waren eigentlich immer schön. Aber die Texte sind oft wirklich eine Zumutung.“ Damit kommen wir zu den anderen solchen. Das sind die Wienerlieder, die die Strottern selbst geschrieben haben, viele with a little help from Peter Ahorner, diesem genialischen Texter, der ihnen Songs wie „Café Westend“, „Bedingungslos“ oder „U1“ vermacht hat (und den die Strottern auf dem Album „mea ois gean“ auch gebührend feiern). Ahorner ist ein immer noch viel zu wenig bekannter Meister der Wiener Dichtung. Seine Reime, Wortspiele, Pointen sind von der traumwandlerischen Sicherheit, die nur die gesprochene Sprache hervorbringt, und die Klemens Lendl mit seinem erzählerischen Gestus kongenial interpretiert.
So nehmen die Songs der Strottern auch auf eine traumwandlerisch sichere Weise Fahrt auf und bewegen sich mit größter Leichtigkeit in die Regionen des Witzes und des Sentiments, und mir nichts dir nichts versetzen sie das Herz des Zuhörers in ungeahnte Schwingungen. Also greift David Müller wieder in die Saiten seiner 120-jährigen Gitarre, d-d-pn-d-d-pnong-d-d-pn-d-d-pnong—wong— und jetzt beginnt Klemens Lendl im „Café Heumarkt“ das Lied zu singen, für das er sich übrigens ganz zu Recht als Star fühlen darf.
„Wia tanzn is“, 2012 auf dem gleichnamigen Strottern-Album erschienen, erzählt die Geschichte einer Liebe, die für ein ganzes Leben bestimmt ist. Sie beginnt im Hier und Jetzt, „wann jedn Tog November is“, sich die Widrigkeiten nur so überschlagen und die Arme des besungenen Du den einzigen Trost spenden; dann schweift das Lied ab in die nahe Zukunft, „wann sie des Glück amoi firetraut“ und die Schulterklopfer und falschen Freunde auftauchen – dann werden diese Arme gebraucht, um das zu ertragen und den Sänger am Boden zu halten; schließlich, in der fernen Zukunft, wenn „kein Geigenspielen“ mehr ist, „nur Zitterhänd’“, dann werden die Arme ganz besonders gebraucht: „dann nimm mi in deine Oam/halt mi in mein Stolz und in mein Zorn“ – und dann kommt diese rührende, überwältigende Erklärung: „weil ans is ma oiweu gwiss/dass des Lebn mit dia/wia tanzn is/wia tanzn is….“
Ich habe dieses Lied sicher schon hundert Mal gehört, vielleicht auch tausend Mal, aber es gehört zu den wenigen Exemplaren seiner Art, die man problemlos auf Repeattaste stellen kann und einen ganzen Vormittag hören oder auch einen späten Abend – Kollegin Doris Knecht hat im Fleischmagazin zur Poetik der Repeattaste einen bemerkenswerten Aufsatz geschrieben, aber das nur nebenbei.
Mit „Wia tanzn is“ ist den Strottern jedenfalls ein Beitrag für das schmale Büchlein ewiger Lieder mit wienerischem Text gelungen, in dem sich ausschließlich Songs von höchster Konzentration, Intensität und Kunstfertigkeit befinden, die nicht für den raschen Verbrauch, sondern ohne Ablaufdatum gemacht sind. Georg Danzers „Lass mi amoi no d’Sunn aufgehn sehn“ befindet sich in diesem Buch, Roland Neuwirths „Kittelfaltn“, Wolfgang Ambros’ „Espresso“, Willi Resetarits’ Artmann-Vertonung „alanech fia di“, Karl Hodinas „I liassert Kirschen für di wachsen“, André Hellers „Und dann bin ich ka Liliputaner mehr“, „De Blia“ von Ernst Molden – und noch ein paar andere, aber viele sind es nicht.
„Ich möchte eben kein Lied zweimal schreiben“, sagt mir Klemens Lendl, als wir im Café Prückel darüber sprechen, warum die Strottern ihr Repertoire so langsam erweitern. Es hat jetzt immerhin sechs Jahre gedauert, bis ein neues Album am Horizont erscheint – es wird „Waunsd woadsd“ heißen und am 25. April erscheinen –, und die Strottern, schon wieder einmal sehr einig, begründen das einigermaßen kokett: „Wir haben immer weniger zu sagen.“ In Wahrheit wollen sie einfach nicht jedes Jahr ein Album machen, „auf dem maximal eineinhalb gute Lieder drauf sind“.
Stattdessen spielen sie Theatermusik, interpretieren Klassisches mit dem Velvet Elevator Orchester, treten bei „Ganymed“ im Kunsthistorischen Museum auf, experimentieren mit der Jazzwerkstatt Wien, spielen Renaissancemusik mit den Blockflöten des Ensemble Mikado und Kinderlieder fürs Lilarum – und haben an ihren Kreuzfahrten durch die Randbezirke der Unterhaltungsmusik ausgesprochen viel Spaß.
„Wir sind“, sagt Klemens Lendl fast entschuldigend, „nicht interessiert an Heiligkeit.“ Aber wenn ihnen dann wieder die Noten für ein Wienerlied, das sie noch nicht kennen, zugesteckt werden, schauen die Strottern sehr genau hin. Wenn das Lied etwas taugt – nicht von der akademischen Warte aus gesehen, einfach als Geschichte, als Song – wird es vielleicht ins Programm gehoben.
„Wir haben uns eine gewisse Unerschrockenheit bewahrt“, sagt Klemens Lendl, „wenn es um die Beurteilung von Qualität geht.“
Die Strottern nennen das eine Win-Win-Situation.
Könnte aber auch eine Wien-Wien-Situation sein.
Christian Seiler – 03.02.2018